Kreative mit ausländischen Wurzeln diskutierten in Gaarden über Herkunft und Kultur

Alle sind irgendwie anders. Erst recht Künstler, deren Individualität quasi ihre Geschäftsgrundlage ist. Fallen aber Kulturschaffende, deren Herkunft nicht in Deutschland begründet liegt, noch einmal in eine besondere Kategorie des Andersseins? Diese Frage stellte der Kultur- und Kreativrat Gaarden in einer Diskussionsrunde mit beachtlichem Unterhaltungswert.
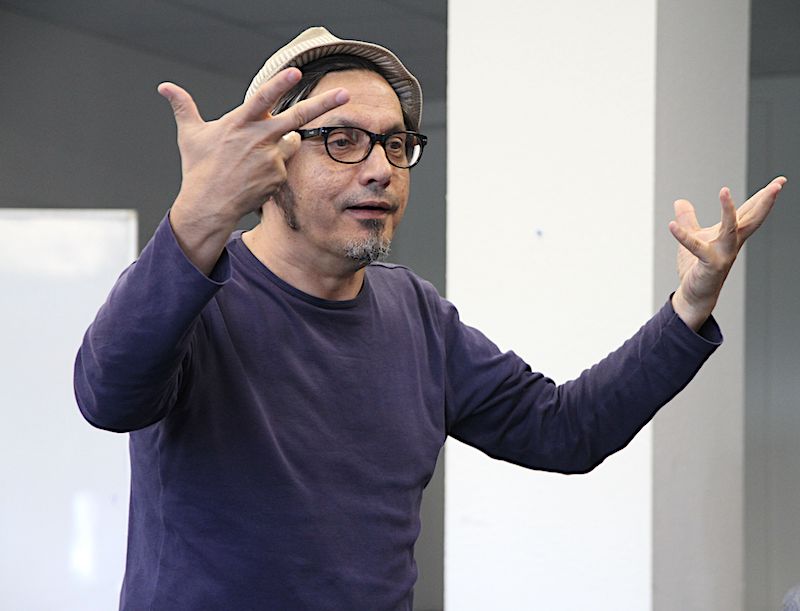
Immerhin etwa 40 Interessierte ließen sich von diesem erstmal sperrig anmutenden Beitrag zum Gaardener Kulturfrühling ins Gebäude der Türkischen Gemeinde locken. Und sie bereuten es kaum, denn dröge ging es ganz und gar nicht her. Was wesentlich ein Verdienst des Karikaturisten und Kabarettisten Mushin Omurca war. Zusammen mit Şinasi Dikmen hatte er 1986 in Ulm das Knobi-Bonbon-Kabarett gegründet, das erste deutschsprachige türkische Kabarett überhaupt.
Wobei Betroffenheitskabarett seine Sache nicht ist. So wie überhaupt die Teilnehmer der Diskussion zuweilen ihre Herkunft mit Sprüchen diskutierten, die einem derart redenden „Biodeutschen“ eher übel angelastet worden wären. Von „Türkenkunst“ sprach der Kieler Bildhauer und Maler Tamer Serbay. Und Omurca machte sich über Bemühungen lustig, die Deutsch-Türken als Opernpublikum zu gewinnen. „Das ist Eure letzte Bastion“, spottete er und warnte davor, diese Zielgruppe auf den Geschmack zu bringen: „Sie machen aus Euren Opernhäusern Hochzeitssäle.“

Ganz ohne Scherz scheint aber schon was dran zu sein an dem Besonderssein migrantischer Künstler. Türkische Themen aufzugreifen, „das erwartet man von mir“, sagt Omurca und gibt zu, sich „schon irgendwie in eine Sackgasse gedrängt“ zu fühlen.
Tamer Serbay, freischaffender Künstler seit 1982, kennt solche Erwartungshaltungen ebenfalls. Im Prinzip wenigstens, denn persönlich hat er sich stets dagegen verwahrt, für die „Türkenkunst“ vereinnahmt zu werden. Nicht als typisch türkisch soll seine Arbeit gesehen werden, sondern schlicht und einfach als Kunst. Serbay konnte sich durchsetzen und ist froh darüber. „Wenn man den Stempel erst einmal hat, ist man leicht raus“, beschreibt er die letztlich existenzielle Gefahr solcher Kategorisierung.

Savas Sari, Sozialarbeiter und Musiker, betrachtet sich selbst „höchstens als Hobby-Künstler“. Und ist überzeugt, dass die Herkunft im Ausdruck und in der Wirkung von Kultur eine nicht zu leugnende Rolle spielt. Die Saz zu spielen, hat er einst vom Vater gelernt. Einem Gastarbeiter, wie es damals hieß, der immerzu traurige Lieder aus der Heimat spielte. Am Sohn bleibt es bis heute hängen, dieses „Gefühl von Heimat und Identität“, das in jedem Ton der Saz mitschwingt. So geht es offenbar nicht nur ihm. Wenn er vor Publikum spielt, äußern die Deutschstämmigen fast immer „positive Resonanz“, sagt Sari. „Wirklich berührt sind aber nur die Anatolier.“
Noch einmal anders sieht es für Momen Saweesh aus. Erst vor zwei Jahren ist er aus Syrien geflüchtet, aber er ist jung. Kaum älter als 20, saugt er die Einflüsse auf wie ein Schwamm, macht heute eine „ganz andere Musik“. Mit seiner Oud, der arabischen Version der Saz, will er zwar den Deutschen ein Stück Kultur seiner Heimat vermitteln. Zugleich will er aber das Neue aufnehmen, sich selbst entwickeln. Inzwischen versteht sich der junge Syrer, der mit der „Safar“-Band in Kiel beachtliche Bekanntheit erlangt hat, konsequenterweise eher als Weltmusiker. Bald wohl werden er und seine Mitspieler das erste norddeutsche Volkslied ins Repertoire aufnehmen – nicht nachspielend, sondern kulturell übersetzend selbstredend.

Mushin Omurca hat unterdessen längst seinen Frieden geschlossen mit den türkischen Themen. Der Mann, der immer wieder in Finnland auftritt und das auch schon in Japan tat, betrachtet die Herausforderung des Umgangs mit den irgendwie Anderen ohnehin als universelles Thema. Für ihn ist das Türken-Motiv eben die Klammer, in die er alles hineinpackt, worüber er sich äußern möchte; Liebe, Geld, Glück, Politik. Seine künstlerische Zwischenbilanz formuliert der unter anderem mit dem Deutschen Kleinkunstpreis ausgezeichnete Kabarettist so: „Ich habe mich nie gefühlt, als ob ich mit meinen Themen in der dritten Liga spielen würde.“
Text und Fotos von Martin Geist
